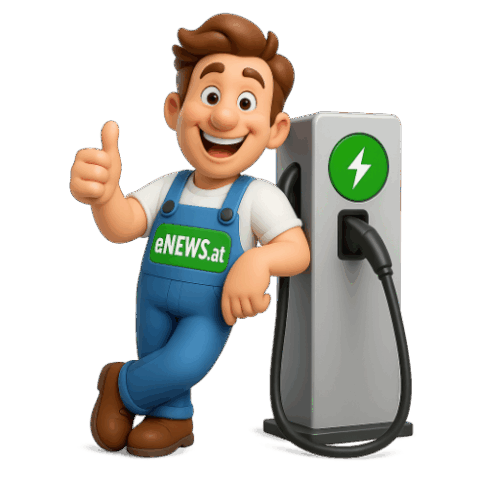Worauf müssen Käufer achten?
Kurzfazit vorab: Der generelle Korrosionsschutz moderner E-Autos ist ordentlich, aber nicht“ erledigt“. Mischbauweisen (Alu/Stahl), offene Falze und schlecht geschützte Anbauteile bleiben Einfallstore – je nach Hersteller sehr unterschiedlich. TÜV-Befunde sehen Bremsen und Fahrwerk häufiger als Problem als Rost; Langzeitdaten speziell zum Rost bei E-Autos sind noch dünn, skandinavische Tests zeigen aber klare Qualitätsunterschiede zwischen den Marken.
Was Rost an E-Autos heute begünstigt
- Mischmaterialien & galvanische Korrosion: E-Autos nutzen viel Aluminium/Magnesium zur Gewichtseinsparung. Treffen diese Metalle ungünstig auf Stahl, kann Kontaktkorrosion entstehen, oft verborgen hinter Verkleidungen und Dämmschaum.
- Bauteile außerhalb der „klassischen“ Karosserie: Unterbodenanbauteile (Querträger, Achskomponenten, Verschraubungen) sowie Radläufe/Schweller sind exponiert – unabhängig vom Antrieb. Fallbeispiele zeigen, dass unversiegelte Bereiche selbst bei jungen Fahrzeugen früh Rostansätze zeigen können.
Langzeiterfahrung & Befunde von Prüforganisationen
- TÜV-Hauptuntersuchung: Der TÜV-Report sieht bei E-Autos (Stand 2023/24) vor allem Bremsfunktion (Rekuperation → Korrosion/Ungebräuchlichkeit der Reibbremsen) und vereinzelt Fahrwerkskomponenten als Schwachpunkte. Rost als Durchfallgrund ist nicht der dominierende Faktor in den Auswertungen. Beispiel: e-Golf sehr gut, Model 3 schwach – aber das bezieht sich auf Gesamtmängel, nicht isoliert auf Rost.
- Fokus „Bremse statt Rost“: Medienzusammenfassungen des TÜV-Reports betonen ebenfalls Brems- statt Rostprobleme.
- Skandinavische Rosttests: Vi Bilägare zerlegt Testwagen und bewertet Rostschutz systematisch; EV-Vergleiche (z. B. ID.4/Enyaq/Polestar 2/Mach-E/Volvo XC40) zeigen starke Streuung nach Modell/Hersteller. Inhalte sind teils hinter Paywall, dokumentieren aber methodisch, wo Hersteller sparen (fehlende Nahtabdichtung/Hohlraumversiegelung, offene Falze).
Hersteller: Wer fällt positiv/negativ auf?
Wichtig: Innerhalb einer Marke variiert der Rostschutz je Modell und Baujahr. Prüfen Sie stets modell- und jahrgangsspezifisch.
- Oft positiv erwähnt (Garantie & werksseitige Maßnahmen):
Volkswagen (ID-Baureihe) – 12 Jahre Durchrostungsgarantie, VW beschreibt zusätzliche Maßnahmen für E-Karosserien (ID.3).
Hyundai/Kia – bis zu 12 Jahre Durchrostung, teils lange Lackgarantien; solide Garantiestruktur in Europa. - Kontrovers/aufgefallen:
Tesla – inzwischen 12 Jahre (unbegrenzt km) Karosserierost-Garantie in Europa; frühere Berichte zeigten jedoch Korrosionsansätze an Unterboden/Struktur schon bei jungen Fahrzeugen (Thema Dämmschaum/Entwässerung). Unterscheiden zwischen Garantie (Durchrostung von innen nach außen) und sichtbarer Oberflächenkorrosion an Anbauteilen.
Chinesische Wettbewerber – wie schlagen sie sich?
- Gesamteindruck: In vielen Tests sind China-Marken auf Augenhöhe bei Fahreindruck, Sicherheit (Euro NCAP) und Qualität; beim Rostschutz gibt es – wie bei europäischen Marken – modellabhängige Unterschiede, und Langzeitdaten in mitteleuropäischen Salzwintern sind naturgemäß noch begrenzt.
- Praxis-Tipp: Bei BYD, MG, Nio & Co. gezielt Unterboden, Hohlräume und Verschraubungen ansehen bzw. dokumentieren lassen; skandinavische Prüfungen (Vi Bilägare) sind gute Referenzen, wenn verfügbar.
Garantien – und was sie wirklich abdecken
- „Durchrostung“ ≠ „Oberflächenrost“: Die Durchrostungsgarantie greift meist erst bei Lochfraß von innen nach außen der Karosserie – Rost an Achsteilen, Schrauben, Bremsscheiben, Hilfsrahmen oder Lackabplatzer ist oft nicht abgedeckt. Prüfen Sie die Bedingungen!
- Typische Zusagen (Beispiele, Europa):
VW/ID-Modelle: 12 Jahre Durchrostung; HV-Batterie: 8 J/160.000 km.
Hyundai/Kia: bis 12 Jahre Durchrostung (modellabhängig); Lack bis 5 Jahre.
Tesla: 12 Jahre Karosserierost (seit 2019, unbegrenzte km).
Gebraucht-E-Auto: Rost-Checkliste (jetzt im Herbst/Winter besonders wichtig)
- Unterboden & Batteriegehäuse: Auf Abplatzer am Unterbodenschutz, beschädigte Steinschlagschichten, korrodierte Schraubenköpfe/Flansche achten; Entwässerungsbohrungen frei? (Salz + Feuchtigkeit = Risiko).
- Radläufe/Schweller & Falze: Radhausschalen anheben/abklipsen lassen, Falze/Nahtabdichtung prüfen (offene, unversiegelte Nähte = Warnsignal).
- Fahrwerk/Traglenker/Hilfsrahmen: Oberflächenrost ist nicht per se kritisch, aber tiefe Narben/Kantenrost sind es; Fotos + Hebebühnenprotokoll mitgeben lassen.
- Bremsanlage: Wegen Rekuperation neigen Scheiben zu Flugrost/Unwuchten – gezielt Probefahrt mit mehr mechanischem Bremsen und HU-Protokolle checken.
- Servicehistorie & Garantiebedingungen: Wartungstermine, Unterbodeninspektionen, dokumentierte Nachkonservierung; prüfen, ob Eigen-Rostschutzmaßnahmen ggf. Garantieeinschränkungen auslösen.
- Preis der Nachkonservierung einplanen: Fachbetrieb (Hohlräume + Unterboden) ca. 800–1.600 €; hält praxisabhängig 5–10 Jahre.
Was sagt der TÜV explizit zu Rostschutz bei E-Autos?
Der TÜV-Verband kommuniziert zu E-Autos vor allem antriebsbedingte Mängel (Bremsen, vereinzelt Fahrwerk), nicht spezifisch vermehrte Rost-Durchfaller. Heißt: Rost ist kein typischer E-Auto-HU-Killer, sollte aber modell- und nutzungsabhängig ernst genommen werden – vor allem dort, wo Materialmix und unzureichende Versiegelungen zusammentreffen.
Einordnung & Empfehlungen
- Rostschutz ist heute „gut – mit Ausnahmen“: Viele Hersteller liefern solide Basis (12-J-Garantie), doch der Schutzgrad unter dem Auto variiert deutlich. Einzelne Modelle zeigen frühe Rostansätze an Anbauteilen/Trägern – auch bei jungen E-Autos.
- China-Modelle: In Sicherheit und Gesamteindruck konkurrenzfähig; Langzeit-Rostdaten in Mitteleuropa sind noch im Aufbau. Individuelle Sichtprüfung bleibt Pflicht.
- Pragmatisch handeln: Beim Kauf Hebebühnen-Check mit Fotodokumentation verlangen, HU-Berichte sichten, und – falls langfristig geplant – professionelle Nachkonservierung einkalkulieren.
© Text enews.at 2025